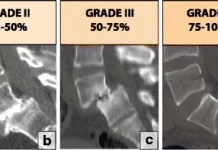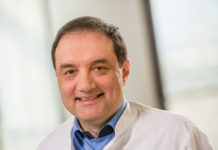Jedes Jahr kommen eine Millionen Besucher nach Köln, um dort Karneval zu feiern. Die Menschen tragen Kostüme, sie singen, tanzen und trinken. Aber gibt es auch viele Notfälle? So hat der Notarzt Dr. Tommaso Coin einen Tag im vergangenen Jahr erlebt.
Als die erste Patientin ins Sanitätszelt gebracht wird, sind schon mehr als drei ruhige Stunden verstrichen. Dr. Coin hat sich mit den Sanitätern unterhalten, die Morgensonne genossen. Er ist eigentlich mehr Nachteule als Frühaufsteher. Damit er länger schlafen kann, hat er am Vortag alles vorbereitet: Den Tagesproviant, die Notarzt-Bekleidung. Als der Wecker um 7.20 Uhr klingelt, steigt er verschlafen in Hose und Stiefel, putzt die Zähne und setzt sich aufs Rad. Sein Wachmacher ist kein heißer Espresso, sondern die kühle Morgenluft.

Die Patientin ist Anfang Siebzig. Sie will nicht, dass eine Infusion gelegt wird. Auch die Einweisung in das Klinikum hält sie für überflüssig, wo sie der Tochter und der Enkelin damit den ganzen Tag verderben würde. Die Sanitäterinnen versuchen sie zu überzeugen, auch die Tochter redet ihr gut zu. Schließlich ergreift der Rettungsassistent das Wort. Er ist ein alter Haudegen, seit über 30 Jahren im Einsatz: „Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Auto mit 4 Zylindern und einer ist kaputt. Bis Essen kommen Sie noch, aber danach heißt es Totalschaden. Sie wollen doch, dass ihre Tochter und ihre Enkelin noch etwas von Ihnen haben.“ Klare Worte, die überzeugen. Die Patientin willigt ein und Dr. Coin, der die direkte Ansprache seines Kollegen mitgehört hat, lächelt.
„Ich bin der Joker“
Auch bei der Übergabe mit dem Fahrer des Krankenwagens spricht nicht Dr. Coin, sondern der Rettungsassistent. Einweisung ins Klinikum, um einen Akutinfarkt auszuschließen. Blut im Labor untersuchen, EKG-Test durchführen. Ein Vorhofflimmern sei bei der Dame aufgetreten, sagt der Rettungsassistent. Jetzt schaltet sich Dr. Coin ein: „Wir wissen nicht, wann das Vorhofflimmern begonnen hat.“
Es macht einen Unterschied, erklärt er später, ob ein Vorhofflimmern gerade erst eingesetzt hat oder seit Wochen besteht. Die Kollegen im Krankenhaus behandeln dann anders. Er hat sich erst zu Wort gemeldet, als es unbedingt notwendig war. Später verrät er, dass er manchmal Probleme hat, sich durchzusetzen. Obwohl er fließend Deutsch spricht, nehmen ihn die Menschen nicht immer ernst.

Als die Patientin abtransportiert ist, kehrt wieder Ruhe ein im Sanitätszelt. Ein Jugendlicher, der mit seinen Freunden unterwegs ist, ruft: „Danke, dass ihr auf uns aufpasst.“ Vom nahen Heumarkt wird der Gesang der Feierenden hochgeweht. Dr. Coin setzt sich auf eine der Krankentragen vor das Zelt. Er ist 29 Jahre alt, gebürtiger Italiener. Als er seine jetzige Frau auf Gran Canaria bei einer Party kennenlernte, studierten sie beide noch Medizin. Die Fernbeziehung hielt, er schrieb sein Examen in Italien und stieg am nächsten Tag in den Flieger nach Köln.
Jetzt holt er sein Heft heraus, und blättert die mit medizinischen Begriffen und Therapiearten beschriebenen Seiten durch. Immer, wenn ihm ein neuer deutscher Fachbegriff über den Weg läuft, schreibt er ihn auf. Je pointierter er mit Kollegen und Patienten sprechen kann, desto besser.

Er arbeitet in einem von 9 Notfallzelten in der Kölner Altstadt. Neben ihm arbeiten in seinem Zelt 16 Sanitäterinnen und Sanitäter. Die Sanitäter gehen immer wieder los, um zu sehen, ob jemand ihre Hilfe benötigt. Dr. Coin bleibt beim Zelt. Falls es zu einem schwerwiegenderen Fall kommt, muss er sofort eingreifen.
Auch auf einen Bombenanschlag sind die Helfer vorbereitet. Dann wird ein Codewort durchgegeben und alle verlassen den Einsatzort möglichst ruhig. Es ist nicht ratsam, zum Anschlagsort zu eilen, weil man nicht wissen kann, ob eine zweite Bombe gezündet wird, erklärt ein Sanitäter.
Das nächste Karriereziel: Bergretter in Garmisch-Patenkirchen

Am frühen Nachmittag ziehen Wolken auf, der Alkoholpegel in der ganzen Stadt steigt weiter an. Ein paar Feiernde kommen zur Ausnüchterung, ein paar andere Leiden werden behandelt. Dr. Coin kümmert sich um einen siebzehnjährigen Jungen mit Platzwunde am linken Auge, der in eine Schlägerei geraten ist. Der Junge zittert, will sich in der Liege immer wieder aufsetzen. Dr. Coin drückt ihn zurück: „Jetzt beruhigst Du Dich!“, sagt er in einem verbindlichen Tonfall.
Schon als Jugendlicher bewunderte Dr. Coin die Notärzte der Bergrettung, die sich bei Schnee und Eis aufmachen. Als er sich bei einem Skiunfall selbst zwei Wirbel bricht und gerettet wird, denkt er: Das will ich auch machen. Die Arbeit als Bergretter in Garmisch-Patenkirchen steht auf seiner beruflichen To-Do-Liste ganz oben.
Und dann ist da noch dieser Unfall in Marrakesch, an denen er denken muss, wenn man ihn nach seiner Berufswahl fragt. Er wartet in einem Mietauto vor einer roten Ampel. Es ist drei Uhr am Morgen, sein Flieger hebt bald ab. Links schlängelt sich ein Junge auf einem Mofa an ihm vorbei. Einen Helm trägt er nicht und rote Ampeln sind nicht für ihn gemacht. Weder der junge Mofafahrer, noch der Fahrer des Renault Scenic sehen sich rechtzeitig. Der Junge fliegt durch die Luft und schlägt auf den Straßenbeton auf, der Fahrer des Renaults drückt aufs Gas, braust mit aufheulendem Motor davon.

Niemand ist auf der Straße, außer Dr. Coin, damals noch Medizinstudent Tommy. Er verstellt die Straße mit seinem warnblinkenden Auto. Sucht nach Warnwesten, Einmalhandschuhen, einem Verbandskasten. Nichts da. Er läuft zu dem Jungen. Er blutet aus den Ohren, schnappt nach Luft, ist nicht ansprechbar. Endlich hält ein vorbeifahrendes Taxi. Es geht darum, die Wirbelsäule des Jungen zu stabilisieren und auf den Krankenwagen zu warten. Es schockiert Tommy, dass er nicht mehr tun kann. Er nimmt sich in diesen bangen Minuten des Wartens vor, so viel zu lernen, dass er bei jedem Notfall die bestmögliche Hilfe leisten kann.
Nach 12,5 Stunden ist sein Dienst an diesem Donnerstag beendet. Er radelt nach Hause, um mit seiner Frau zu Abend zu essen. Im Flur begrüßen sie sich leise, die elf Monate alte Tochter schläft seit kurzem sehr unruhig. „Wie war es?“, fragt sie ihn später beim Essen. Er arbeitet noch kein halbes Jahr als Notarzt in Köln, aber in einem seiner Dienste her er bereits drei Suizide dokumentieren müssen: „Es war nicht viel los!“
Alle Fotos: ©Michael Gallner